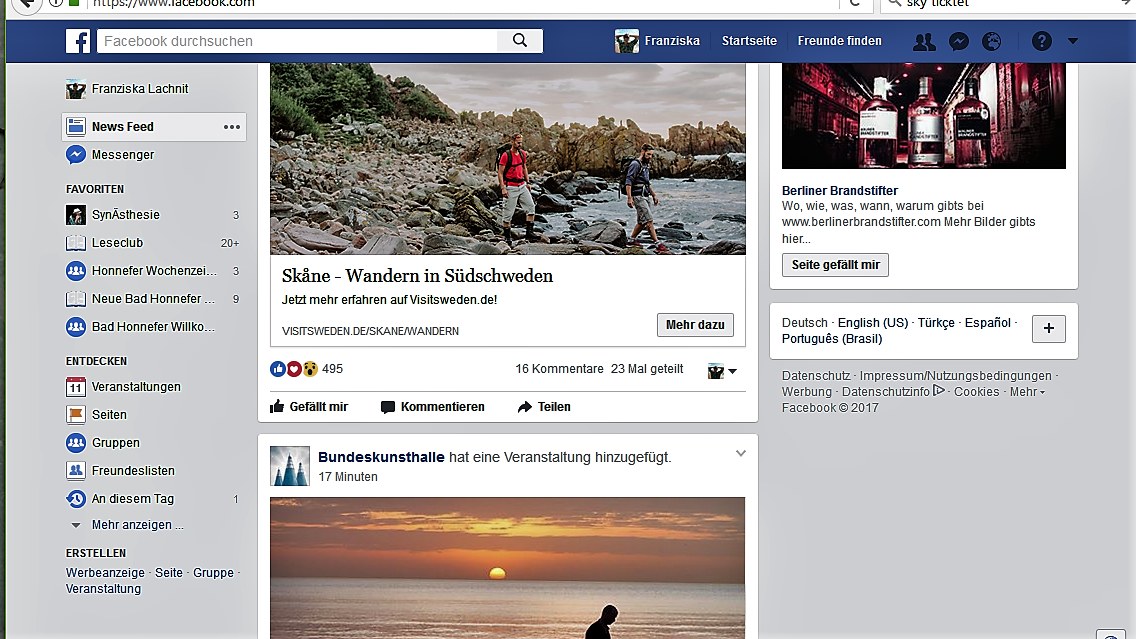„Claudia! Ich gehe mal eben Zigaretten holen.“ Der Automat steht nur ein paar Meter entfernt in der nächsten Seitenstraße. Dennoch geht er zum Tabakladen in die Stadt. „Ich habe schließlich Urlaub!“ – und so setzt er sich beim nächst gelegenen Lokal an einen sonnenbeschienenen Tisch, um das erste Bier zu bestellen. Es ist Mittagszeit.
Also ist er umgeben von einigen anderen, die hier eine Pause einlegen: Geschäftsleute, ältere Ehepaare, sowie Ausflügler. Er bestellt das zweite Bier. „Das wenigstens muss im Urlaub drin sein!“ – rechtfertigt er sich im Stillen. Erst letzte Woche sind sie aus den Sommerferien von Mallorca zurückgekehrt – Claudia, die beiden Söhne und er. Jedes Jahr Mallorca! Und dabei würde er viel lieber eine Fernreise in ein unbekanntes Land unternehmen.
Claudia möchte das nicht: zu teuer für eine ganze Familie – aber die Jungs sind eigentlich alt genug, um mal alleine zu bleiben. Das würde ihnen sogar gefallen! Zu anstrengend – findet Claudia: Die Vorbereitungen wie Visum, Impfungen etc. Und dann die Reise mit Jetlag und der ganzen Umstellung. Alles zu stressig für die Ferien.
Jedes Jahr ist er enttäuscht. Während er darüber nachdenkt, dass seine Ehe ganz gut ein Abenteuer gebrauchen könnte, bestellt er ein weiteres Bier. „Die meiste Zeit des Jahres schufte ich. Mein unverhoffter Karrieresprung, das gigantische Gehalt, mein Traumauto! Das alles ist hart erarbeitet.“ Zur Belohnung lässt er sich noch ein Bier bringen.
Seine Gedanken werden lauter, allerdings unartikulierter. Als ein Bekannter vorbei kommt, lädt er ihn mit gellender Stimme auf ein Bier ein. Eine unkoordinierte Unterhaltung nimmt ihren Lauf. Jeder redet. Keiner hört zu. Aus beschwingt wird beschwippst und schließlich betrunken. Der Abend bricht gerade erst an, als sich die beiden schwankend auf den Heimweg begeben. Franziska Lachnit (2017)